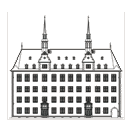
Alte Universitätsstraße 19
55116 Mainz / Germany
Tel.: +49/6131 / 3 93 93 60
| Büttner, Bengt *
|
|
zurück zur Ergebnisliste

|
ISSN: 1867-9714
Gliederung:
1. Einführung
2. Innerskandinavische Schiedsbestimmungen bis zur Kalmarer Union
3. Die Schiedsgerichtsbarkeit im Zeitalter der Kalmarer Union
4. Zwischenstaatliche Schiedsgerichtsbarkeit vom Ende der Kalmarer Union bis zum Frieden von Stettin
5. Das Scheitern der zwischenstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit seit dem Stettiner Frieden
Anmerkungen
Zitierempfehlung
Text:
Am 13. Dezember 1570 verkündete Herzog Johann Friedrich von Pommern an der Spitze der vom Kaiser, von den Königen von Frankreich und Polen sowie dem Kurfürsten von Sachsen beauftragten Vermittler den Frieden von Stettin.[1]
Zum Einen wurde die Drei-Kronenfrage, die wesentlich zum Kriegsausbruch beigetragen hatte, an ein Schiedsgericht des Kaisers, der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel und des Pfalzgrafen von Veldenz überwiesen (Art. 4), falls Dänemark und Schweden bis zum 1. Januar 1572 nicht doch eine interne Lösung für ihren Streit um die Führung des Drei-Kronenwappens finden konnten. Die Prozessführung des Schiedsgerichts wurde einem Ausschuss aus Vertretern von Stadt und Universität Rostock übertragen. Bei diesem Ausschuss sollten beide Seiten in den Jahren 1572, 1573 und 1575 ihre Prozessschriften hinterlegen, und dort sollte an einem festgesetzten Tag des Jahres 1573 auch eine Zeugenvernehmung stattfinden. Beide Seiten verpflichteten sich dazu, einem Schiedsspruch des Kaisers und der anderen Fürsten nachzukommen und auf die Einlegung von Rechtsmitteln dagegen zu verzichten.[2]
Zusätzlich zu dieser so genannten »isolierten« Schiedsgerichtsbarkeit in einer bereits bestehenden Streitsache errichtete der Friedensvertrag von Stettin eine »institutionelle« Schiedsgerichtsbarkeit für künftig aufkommende Streitfälle zwischen beiden Nationen.[3]
Am festgesetzten Termin »an beider reiche grentzen oder sonst einem gelegenen ort« sollten sich die zwölf Reichsräte bei beiden Streitparteien über den Sachverhalt erkundigen und anschließend so lange beieinander bleiben, bis sie die Parteien entweder gütlich verglichen oder einen Schiedsspruch zwischen ihnen verkündet hätten. Bei Stimmengleichheit innerhalb des Schiedsgremiums war es den beiden Königen vorbehalten, einen Obmann zu bestellen, der durch seinen Anschluss an eines der beiden Schiedsrichtervoten eine Entscheidung herbeiführen würde. Die Könige wurden darauf verpflichtet, einen solchen Schiedsspruch zu befolgen; anderenfalls waren ihre Reichsräte und Untertanen so lange von ihren Untertaneneiden entbunden, bis sich der vertragsbrüchige König wieder an das Urteil hielt. Eine ähnliche Schiedsgerichtsbarkeit legte der Friedensvertrag prinzipiell auch für Grenzstreitigkeiten sowie für grenzüberschreitende Streitfälle zwischen einzelnen Adeligen oder Städten fest, doch konnte die Anzahl der dafür abgeordneten Reichsräte je nach der Bedeutung dieser Fälle variieren (Art. 25).[4]
Mit seinem mehrstufigen Mahn- und Beilegungsverfahren, mit dem Mehrheitsbeschluss der Schiedsrichter, der bindenden Wirkung ihrer Urteile und dem Widerstandsrecht gegen einen widerstrebenden König stellt der Friedensvertrag von Stettin sicherlich einen Höhepunkt in der Entwicklung der zwischenstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit in Skandinavien dar, doch waren seine Schiedsbestimmungen dort keineswegs revolutionär. Vielmehr stehen sie in einer langen Tradition, die sich im Verhältnis der skandinavischen Reiche untereinander seit dem Mittelalter ausgebildet hatte. Der folgende Beitrag soll zum Einen herausarbeiten, wie sich die Schiedsgerichtsbarkeit zwischen Dänemark und Schweden von ihren mittelalterlichen Anfängen bis zum Stettiner Frieden 1570 entwickelt hat. Dabei soll der Beitrag gegebenenfalls auf besondere, typisch skandinavische Merkmale in der Ausprägung des Schiedswesens hinweisen und der Frage nachgehen, ob es sich bei der skandinavischen Schiedsgerichtsbarkeit um eine autochtone Entwicklung oder um eine Übernahme fremder Elemente handelt. Zum Anderen will der Beitrag eine Erklärung dafür suchen, warum die 1570 etablierte, genau ausgearbeitete Schiedsgerichtsbarkeit zwischen beiden Ländern in den folgenden Jahrzehnten kaum zur Anwendung gekommen ist und letztlich nicht zu einer dauerhaften Entspannung zwischen Dänemark und Schweden beigetragen hat.
2. Innerskandinavische Schiedsbestimmungen bis zur Kalmarer Union
Ein frühes Beispiel für die Vereinbarung und Anwendung der Schiedsgerichtsbarkeit zwischen den skandinavischen Reichen ist 1285 aus Kalmar überliefert. Hier verkündete der schwedische König Magnus Ladulås (reg. 1275–1290) als Obmann einen Schiedsspruch zwischen dem König von Norwegen und sieben Hansestädten, nachdem sich ein aus je zwei Parteienvertretern besetztes Schiedsgericht nicht über die Streitpunkte einig geworden war. Zusätzlich zu seinem Schiedsspruch vermittelte der schwedische König eine institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit zwischen Norwegen und Dänemark, das mit den Seestädten verbündet war. Die Urteilsfindung wurde an ein Gremium aus je einem Parteienvertreter übertragen, die gemeinsam den dritten Schiedsrichter zu wählen hatten; diese Drei sollten dann nach dem Mehrheitsprinzip entscheiden.[5]
Zu Anfang des 14. Jahrhunderts boten innerschwedische Thronkämpfe neue Gelegenheiten für die Vereinbarung von Schiedsgerichten. Der quasi »zwischenstaatliche« Charakter[6]
Als neues Element erscheint in den Schiedsvereinbarungen zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Bestimmung, dass bereits benannte, bis zum festgesetzten Schiedstermin aber verstorbene Schiedsrichter durch Nachrücker ersetzt werden sollten (Helsingborg 1312, Roskilde 1318), was für eine gewisse Verfestigung des Schiedsrichteramts spricht.[9]
Es dürfte allerdings schwer fallen, einzelne Merkmale dieser Schiedsvereinbarungen eindeutig entweder aus dem skandinavischen Rechtswesen oder aus fremden Rechtseinflüssen abzuleiten, zumal ein Merkmal wie das paritätisch von den Parteien besetzte Urteilergremium sowohl in der deutschen als auch in der skandinavischen Zivilgerichtsbarkeit (»skiladómr«) vorkommen kann.[11]
Bei paritätisch besetzten Urteilerausschüssen spricht man von »beauftragten Schiedsrichtern«, bei neutralen Schiedsherren von »erbetenen Schiedsrichtern«. Im zwischenstaatlichen Bereich waren die beauftragten Schiedsrichter in der Regel eigene Räte, während es sich bei den erbetenen Schiedsrichtern meist um fremde Fürsten (bzw. um deren Beauftragte) handelte.[15]
Für die praktische Umsetzung der frühen skandinavischen Schiedsvereinbarungen gilt bereits dasselbe, was Karl Heinz Lingens in seiner Studie 1988 angeführt und mitverantwortlich gemacht hat für den allgemeinen Niedergang der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit in der Frühen Neuzeit: Nur die wenigsten Schiedsabsprachen haben nach langwierigen Verfahren tatsächlich zu einem Schiedsspruch geführt. Bei anderen bleibt unklar, ob jemals ein Urteil gefällt worden ist, und viele sind vermutlich niemals umgesetzt worden. Für den schwedischen Historiker Nils Ahnlund sagen die immer wiederkehrenden Schiedsabreden in Konfliktphasen deshalb auch mehr über das Bedürfnis nach einer Schiedsinstitution aus als über deren Respektierung und Effektivität.[17]
Eine nächste solche Phase fällt in die 40er Jahre des 14. Jahrhunderts, als sich König Valdemar Atterdag (reg. 1340–1375) nach seiner Thronbesteigung daran machte, die Pfandherrschaft der Grafen von Holstein in Dänemark abzulösen. Bei einer ersten Übereinkunft im Jahre 1341 in Kalundborg unterwarfen sich Valdemar und die holsteinischen Grafen einem Schiedsgericht von jeweils vier von den Parteien beauftragten Schiedsrichtern. Konnten diese keine Einigung erzielen, dann sollte der Erzbischof von Lund eine endgültige Entscheidung fällen.[18]
Falls diese in ihrem Spruch nicht übereinstimmten, war auch hier der Erzbischof von Lund als Obmann über den künftigen Besitz der Burg Kopenhagen vorgesehen. Weitere Bestimmungen regelten den Fall, dass einzelne der erwählten Schiedsrichter oder auch der Erzbischof bis zum Schiedstermin sterben würden. Schließlich gestanden die Könige ihren Vertragsbürgen das Widerstandsrecht zu, falls sie selbst gegen die Schiedsvereinbarung verstießen. Anstatt einen Schiedsspruch zu verkünden, einigten sich beide Seiten drei Monate später in Varberg bei einem Vergleich auf eine institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit zwischen Dänemark und Schweden. Sie sollte vor je sechs von beiden Seiten entsandten Schiedsrichtern stattfinden, die innerhalb von zwölf Wochen nach Klageerhebung in Helsingborg zusammentreten würden. Je drei der sechs Schiedsherren einer Seite sollten sich aus den Bischöfen, die übrigen aus dem weltlichen Adel rekrutieren. Als Obmänner sollte das Schiedsgremium je einen Dänen und einen Schweden bestimmen, welche die ihnen vorgelegte Streitsache als letzte Instanz unter Eid entscheiden könnten. Wie in Helsingborg erhielten die Bürgen das Widerstandsrecht für den Fall königlicher Verstöße gegen den Vergleich. Zur Bekräftigung wurde die Schiedsvereinbarung auch in die auf denselben Tag datierte Urkunde Valdemars über den Verkauf von Schonen, Halland und Blekinge an den König von Schweden hineingeschrieben. Als zusätzliche Sanktion enthielt die Verkaufsurkunde die Exkommunikation Valdemars bei Vertragsbruch, auszusprechen durch die sechs Bischöfe des Schiedsgerichts sowie drei weitere schwedische Bischöfe.[19]
Im Unterschied zu vorher passten die Schiedsabsprachen von Helsingborg und Varberg 1343 die Zahl der beauftragten Schiedsrichter an das Duodezimalsystem des skandinavischen »skiladómr« in Grenz- und Grundstücksangelegenheiten an.[20]
Die in den Schiedsabreden von 1343 bereits gemeinte, aber noch nicht ausdrücklich benannte Institution der Reichsräte hatte sich in allen drei skandinavischen Königreichen in den Jahrzehnten um 1300 aus älteren, zunächst noch locker gefügten Beraterkreisen im königlichen Umfeld herausgebildet und setzte sich bis zum Ende des 14. Jahrhunderts als einziges Organ ständischer Mitregierung neben den Monarchen durch. Die Reichsräte rekrutierten sich aus Vertretern des Hochadels und – zumindest bis zur Reformation – der hohen Geistlichkeit innerhalb der drei Reiche. Zwar wurden sie vom König ernannt und vereidigt, doch galten die Inhaber der Hofämter und die Bischöfe mit der Zeit als selbstverständliche Mitglieder der jeweiligen Ratsgremien; in Schweden ergänzte sich der Reichsrat im 15. Jahrhundert sogar selbstständig durch Kooptation. In ihrer Doppelfunktion sowohl im Dienst als auch zur Kontrolle des Königs monopolisierten sie die Königswahl und schränkten die königliche Regierungsgewalt durch Wahlkapitulationen ein.[21]
3. Die Schiedsgerichtsbarkeit im Zeitalter der Kalmarer Union
Es mag erstaunen, dass keines der auf dem Unionstreffen von Kalmar 1397 entstandenen Dokumente – weder der Krönungsbrief noch der Unionsbrief – irgend welche Bestimmungen zur Schiedsgerichtsbarkeit enthält. Offenbar waren die Verantwortlichen vom künftig herrschenden Geist der Solidarität und Kooperation zwischen den skandinavischen Reichen so überzeugt, dass sie ein solches Instrument für entbehrlich hielten.[23]
Nachdem der schwedische Reichsrat dem König zum ersten Mal die Gefolgschaft gekündigt hatte, einigten sich beide Seiten im November 1434 auf einen Waffenstillstand und ein Schiedsverfahren. Dafür sollte im folgenden Jahr ein Schiedsgremium aus zwölf Reichsräten in Stockholm zusammentreten, und zwar je vier Räte aus jedem der drei Reiche (Dänemark, Schweden und Norwegen), um die Streitpunkte zwischen dem König und seinem Reich Schweden nach schwedischem Recht beizulegen.
Ein Präliminarfrieden stellte Erik im Mai 1435 seine erneute Anerkennung als schwedischer König in Aussicht, falls er sich beim Schiedstreffen in Stockholm zu Zugeständnissen an die Schweden bereitfände, so dass die Anerkennung Eriks bereits im Vorfeld wieder vom Schiedsverfahren ausgenommen war.[25]
Zu diesem Treffen kam es jedoch nie, denn König Erik hielt sich nicht an die Vergleichsartikel, so dass ihm die Schweden Anfang 1436 erneut die Gefolgschaft aufsagten. Beide Seiten vereinbarten einen Waffenstillstand sowie ein Treffen in Kalmar, um unter hansischer Vermittlung nach einem neuen Vergleich zu suchen.[27]
Nachdem die beiden Parteien den von den Vermittlern ausgearbeiteten Vergleichsvorschlag verworfen hatten, war König Erik zur Durchführung des Schiedsverfahrens entschlossen. Die Schweden waren darauf jedoch nicht vorbereitet und vermochten auch die dänischen und hansischen Schiedsrichter davon zu überzeugen, wie untunlich ein solches Verfahrens sei! So geschah es, dass die Schiedsrichter vor den König traten, ihm von einem Schiedsgericht abrieten und stattdessen den Rat erteilten, er möge die Schweden in Freundschaft und Gnaden wieder aufnehmen, »wente se konden alle merken, dat rechtgank twischen en beiden noch vruntschop noch endracht noch vrede maken konde«.[29]
Das Regiment seines Nachfolgers, des Königs Kristoffer von Bayern (reg. 1440–1448), markierte in allen drei skandinavischen Königreichen den Höhepunkt für die ratskonstitutiona-listische Auffassung der Unionsmonarchie und machte keine weiteren Schiedsabsprachen notwendig.[31]
Gleich nach dem Tod Kristoffers unternahm der neue schwedische König Karl VIII. (reg. 1448–1470 mit mehreren Unterbrechungen) den Versuch, die Insel Gotland für Schweden zurückzugewinnen. Die Landung eines dänischen Entsatzheeres beschwor jedoch die Gefahr von Feindseligkeiten zwischen Dänen und Schweden herauf. Zur Abwendung dieser Gefahr einigten sich die beiden Militärbefehlshaber auf Gotland im Juli 1449 auf zwei Waffenstillstände. Über die Zugehörigkeit der Insel sollte im Mai 1450 in Halmstad entschieden werden, wohin beide Seiten je zwölf Reichsräte mit der Vollmacht zum Vergleich oder zur Schiedsentscheidung aller zwischen Dänemark und Schweden strittigen Fragen entsenden sollten.[33]
Im Jahre 1457 erlangte der dänische König Christian I. (reg. 1448–1481) endlich die ersehnte Anerkennung als schwedischer König, vermochte sie jedoch angesichts schwedischer Aufstände und rasch wechselnder Adelskoalitionen im schwedischen Reichsrat nicht lange zu behaupten. Ein Versuch, sich mit Gewalt in Schweden durchzusetzen, scheiterte 1471 mit der Niederlage Christians auf dem Brunkeberg (vor Stockholm).[36]
Tatsächlich hatten sich die »Schiedsverhandlungen« in Kalmar allmählich zur gängigen Form der Friedensverhandlungen zwischen Dänemark und Schweden entwickelt. Die von den Schiedsherren verkündeten Abschiede waren keine Schiedssprüche, sondern sind von der schwedischen Forschung als »Verträge über Verträge« (»traktater om traktater«) bezeichnet worden, mit der Funktion, einen neuerlichen Kriegsausbruch von einem Treffen bis zum nächsten hinauszuzögern.[38]
Von den zahlreichen Vergleichs- und Schiedsabsprachen aus der Endphase der Kalmarer Union hat nur eine einzige tatsächlich zu einem Urteil geführt. Dieses »Schiedsurteil« von Kalmar brachte 1505 jedoch auch keine Lösung, denn es war einseitig durch den Spruch von je zwölf dänischen und norwegischen Reichsräten (und eines königlichen Prokurators) zustande gekommen, nachdem die beklagten Vertreter des schwedischen Reichsrats dem im Jahr zuvor vereinbarten Unionstag fern geblieben waren.[41]
Ein Vergleich soll belegen: Sofern die Dänen während der Unionszeit Schiedsabreden mit anderen Partnern als ihren schwedischen Nachbarn eingingen, beauftragten sie nur selten ihre Reichsräte als Schiedsrichter. Von den zahlreichen Schiedsvereinbarungen und verhandlungen, mit denen der dänische König und die Grafen von Holstein zwischen 1410 und 1435 ihren Streit um den Lehnsbesitz des Herzogtums Schleswig zu beenden versuchten, enthielt zwar der Waffenstillstand von Kolding 1411 die Bestimmung über ein Schiedsgericht aus je sechs Räten aus Dänemark und dem Herzogtum. Falls diese sich nicht einigen konnten, sollten sie zunächst zwei Obleute bestimmen und ihren Streit zuletzt vor den Kaiser bringen.[44]
Im Jahre 1417 waren es jeweils zwei von zwölf Fürsten (»borne heren«) sowie Vertreter von je vier Hansestädten, aus denen sich ein für 1418 verabredeter Schiedsausschuss zusammensetzen sollte. Als Obmänner waren zwei Fürsten vorgesehen.[46]
Erst nachdem Dänemark 1460 durch eine Personalunion mit den Herzogtümern Schleswig und Holstein verbunden worden war, kamen die Räte wieder als Schiedsrichter zwischen beiden Seiten ins Spiel. 1533 etablierte der Unionsvertrag von Rendsburg eine institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit durch jeweils acht Räte als beauftragte Schiedsrichter für Streitigkeiten zwischen dem Königreich und den Herzogtümern (Art. 2–3). Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten zwischen ihren Untersassen sollten jeweils vier Räte urteilen (Art. 5–6). Für den Fall eines gespaltenen Votums war ein Obmann aus der Mitte des Schiedsgremiums vorgesehen.[52]
Ein dänisch-polnischer Waffenstillstand enthielt 1458 die Vereinbarung eines Schiedsgerichts, das 1459 in Lübeck zusammentreten und aus jeweils zwei Schiedsrichtern bestehen sollte. Bei den Schiedsrichtern handelte es sich um den Grafen von Holstein sowie um die Vertreter Lübecks und zweier weiterer Hansestädte, die den Waffenstillstand 1459 und 1462 zweimal verlängerten.[54]
Vor dem Hintergrund dieser dänischen Schiedsabreden mit anderen Partnern als den Schweden ist die Funktion der Reichsräte als Vermittler zwischen ihren Königen und als Richter über dieses als Ausdruck einer dänisch-schwedischen Sonderbeziehung zu begreifen, die bis in die Zeit vor der Kalmarer Union zurückreicht, die Union überdauerte und erst im 17. Jahrhundert beendet wurde.
4. Zwischenstaatliche Schiedsgerichtsbarkeit vom Ende der Kalmarer Union bis zum Frieden von Stettin
Mit der Vertreibung Christians II. (reg. 1513–1523) zuerst aus Schweden (1521), dann auch aus Dänemark (1523), und nach dem Herrschaftsantritt der neuen Könige Gustav I. (reg. 1521–1560) und Frederik I. (reg. 1523–1533) hörten die ständigen Verhandlungen über eine Thronbesteigung des dänischen Königs in Schweden auf. Einerseits wurden Dänemark und Schweden nun noch enger zusammengeschweißt durch die gemeinsame Front gegen den vertriebenen König Christian II., der, unterstützt von seinem Schwager Kaiser Karl V., von den Niederlanden aus seine Rückkehr betrieb. Andererseits blieb König Gustav sein Leben lang von einem tiefen Misstrauen gegen jede dänische Regierung und ihre – realen oder auch nur vermeintlichen – Bestrebungen zur Erneuerung der Unionsmonarchie geprägt. Ebenso misstrauisch verfolgte Gustav die fortlebenden Unionssympathien innerhalb des schwedischen Adels. Eine erste Bestätigung schien sein Misstrauen im Juni 1523 mit dem Aufruf Frederiks an die schwedischen Stände zu erhalten, den Nutzen einer fortgesetzten nordischen Union zu bedenken und sich unter seine Herrschaft zu begeben. Umgekehrt hatte jedoch auch Gustav nicht gezögert, bei seiner Thronbesteigung alte schwedische Ansprüche auf die dänischen Landschaften Schonen, Halland und Blekinge wiederzubeleben. Die dänisch-schwedische Sonderbeziehung dauerte unter den neuen Vorzeichen wechselseitiger Unabhängigkeit weiter an: Beide Länder blieben geradezu aufeinander fixiert und waren weiter auf ein enges Verhältnis angewiesen, als Partner gegen äußere Bedrohungen ebenso wie als Rivalen um die Vormachtstellung auf der skandinavischen Halbinsel und im gesamten Ostseeraum.[55]
Einen alten Streitpunkt zwischen Dänemark und Schweden bildete die Insel Gotland (siehe oben). Dort hatte sich ein Anhänger Christians II. verschanzt, betrieb Piraterie und versuchte angesichts neuer schwedischer Anstrengungen zur Eroberung der Insel, die beiden neuen Könige gegeneinander auszuspielen. Nachdem die Situation auf Gotland zu einer ernsten Belastung des dänisch-schwedischen Verhältnisses geworden war, fand sich König Gustav auf Druck der Hansestädte zu einem Königstreffen bereit, das im September 1524 in Malmö stattfand. Wie sehr das Misstrauen zwischen beiden Seiten schon wieder angewachsen war, zeigt die Tatsache, dass der schwedische König von den Dänen und Hanseaten nicht nur Geleitbriefe, sondern sogar die Stellung von Geiseln verlangte, bevor er sich nach Malmö begab.[56]
Die Verhandlungen fanden unter Vermittlung hansischer Sendboten zwischen zwei Delegationen von je sechs Reichsräten statt, ähnlich wie die letzten Unionstreffen wenige Jahre zuvor. Ihr Resultat war eine Schiedsvereinbarung, nach der sechs wendische Hansestädte durch ihre Vertreter zu Pfingsten 1525 in Lübeck über die Zugehörigkeit Gotlands, über die Rückgabe der von schwedischen Truppen besetzten Landschaft Viken in Süd-Norwegen und über eine dänische Erstattung der schwedischen Kriegsaufwendungen gegen Christian II. befinden sollten. Der schwedische Historiker Sven Ulric Palme hält es für charakteristisch, dass der Rezess von Malmö die Urteilsfindung in fremde Hände legte. Angesichts der noch unsicheren Stellung Gustavs gegenüber dem schwedischen Adel habe die traditionelle Urteilsfindung durch einen Reichsräteauschuss ein zu großes Risiko für den schwedischen König dargestellt. Ein formelles Bündnis zwischen Dänemark und Schweden wurde in Malmö zwar nicht errichtet, doch verpflichtete der Rezess die beiden Nachbarn immerhin zur Aufrechterhaltung von Frieden und Freundschaft sowie zur gegenseitigen Förderung (Art. 22). Vertragsverletzungen sollten mit einer Buße von 100.000 fl. zugunsten der vertragstreuen Partei geahndet werden (Art. 21).[57]
König Gustav war sehr unzufrieden mit dem Ergebnis und fühlte sich von den Lübecker Vermittlern betrogen. Folglich verweigerten die Schweden zunächst die Schiedsverhandlungen 1525 und sabotierten sie dann, indem ihre Gesandten erst mit wochenlanger Verspätung in Lübeck eintrafen, als die Dänen längst wieder abgereist waren. Es brauchte deshalb mehrere Anläufe, bis man 1528 ein neues Königstreffen verabreden konnte, diesmal in Lödöse auf schwedischem Boden.[58]
Auch hier war König Gustav von vornherein verärgert, da der dänische König Frederik entgegen der Absprache nicht am Treffen teilnahm. Stattdessen verhandelte eine Delegation von fünf dänischen Reichsräten mit König Gustav und dem schwedischen Ratsgremium, ohne eine Einigung zu erzielen. Die Schweden erhoben Anspruch auf Gotland, die Dänen forderten die Landschaft Viken zurück, und beide Seiten verklagten sich gegenseitig auf die 1524 festgesetzte Vertragsbuße. Nachdem man eingesehen hatte, dass keine Einigung möglich war, mit der – angesichts der langen Tradition von Schiedsabreden mit beauftragten Schiedsrichtern merkwürdigen – Begründung, dass die Parteien nicht Richter in eigener Sache sein könnten (»vi, som saken anrörer på bådha sidhor, kunne icke sielfve vara vore eghne eller hvar annars domara«), vertagte man die Streitpunkte bis zu einem künftigen Königstreffen, um sich keine Blöße gegen den gemeinsamen Feind Christian II. zu geben. Dort sollten die bestehenden Differenzen entweder gütlich oder durch ein Schiedsgericht beigelegt werden (Art. 1). Außerdem schlossen die Parteien einen Beistandspakt gegen Christian II. (Art. 2–5).[59]
Nachdem sich König Gustav der dänischen Forderung nach einem Schiedstreffen 1529 widersetzt hatte, kamen die Reichsräte beider Seiten 1530 zu neuen Verhandlungen über Gotland und Viken in Varberg zusammen. Auch hier waren die dänischen Gesandten zur Forderung nach einem Schiedsgericht aus je sechs Reichsräten instruiert. Eine Übereinkunft kam indessen nach harten Verhandlungen ohne die Einsetzung eines Schiedsgerichts zustande, allerdings erst, nachdem die drei ältesten dänischen Reichsräte eine Vermittlerrolle übernommen hatten. Die Landschaft Viken sollte nun nach sechs Jahren zurück an Norwegen fallen; der schwedische Rechtsanspruch auf Gotland blieb erhalten, und auch die Freundschafts- und Beistandsartikel der Rezesse von 1524 und 1528 wurden leicht modifziert bestätigt.[60]
Die Beistandsartikel bewährten sich für Dänemark in den folgenden Jahren, als ein Feldzug Christians II. nach Norwegen mit schwedischer und Lübeckischer Hilfe abgeschlagen und Christian selbst in Dänemark gefangengesetzt wurde.[61]
Ein interessantes Schlaglicht auf das Fortleben der Unionsidee wirft die Bestimmung über den Widerstand gegen einen vertragsbrüchigen König (Art. 17): Falls der König eines der drei Reiche (Dänemark, Norwegen, Schweden) in eines der beiden anderen einziehen würde, sollten die Einwohner der anderen beiden Reiche in ihrem Widerstand gegen ihn zusammenstehen – es sei denn, der König handele mit dem Rat des Reichsrats, mit Zustimmung und nach freier Wahl durch Adel und Einwohner desjenigen Reiches, in das er einzog! In dieser Einschränkung verbarg sich nichts weniger als die Wiedererrichtung der Unionsmonarchie, die man offenbar nach wie vor für möglich hielt.[64]
Der militärische Beistand gegen Lübeck erfüllte seinen Zweck in der so genannten »Grafenfehde« (1534–1536), in der Schweden seinen dänischen Nachbarn mit Soldaten, Kriegsschiffen und Krediten gegen einen Lübecker Überfall unterstützte. Tatsächlich gewährten die Schweden ihre Unterstützung sogar schon zu einem Zeitpunkt, als das Bündnis noch gar nicht rechtsgültig bestand, denn noch vor der Ratifikation war das dänische Unterhändlerinstrument den Lübeckern in die Hände gefallen. Über die militärische Zusammenarbeit hinaus führte das Bündnis jedoch nicht zu einer dauerhaften Entspannung zwischen Dänemark und Schweden: Obwohl der neue dänische König Christian III. (reg. 1534–1559) im Herbst 1535 nach Stockholm reiste, eine vorläufige Ratifikation ausstellte und norwegische Lehen als Pfandschaften für weitere Kredite versprach, verschlechterten sich die Beziehungen nach dem Ende der Grafenfehde rasch wieder. Den Grund dafür bildeten weitere Unstimmigkeiten über die Ratifikation des Bündnisvertrags sowie die dänische Weigerung, die verpfändeten Gebiete (und nicht nur die Einkünfte daraus!) wirklich an Schweden auszuliefern. Außerdem waren die Schweden mit den Friedensbedingungen unzufrieden, die Dänemark 1536 mit Lübeck und den übrigen Hansestädten ausgehandelt hatte. Sie sollten auch für Schweden gelten, doch fühlten sich die Schweden von Dänemark bevormundet.[65]
Im Dezember 1536 vereinbarten Dänen und Schweden ein Schiedsgericht aus je sechs Adeligen, das über einige noch aus der Unionszeit herrührende adelige Besitzstreitigkeiten befinden und im Juli 1537 in Halmstad zusammenkommen sollte. Als es schließlich mit zwei Monaten Verspätung zusammentrat, konnte kein Urteil verkündet werden, denn beide Seiten hatten das Schiedsverfahren sabotiert: Die Schweden hatten keine Vorladungen der dänischen Beklagten erwirkt, während sich die dänischen Beklagten von der Teilnahme am Schiedstreffen entschuldigen ließen, so dass sich das Schiedsgericht bis Pfingsten 1538 vertagte. Tatsächlich kam es nie wieder zusammen, und das dänisch-schwedische Verhältnis spitzte sich weiter zu, bis zu Beginn des Jahres 1540 ernsthaft ein Kriegsausbruch befürchtet werden musste.[66]
Der Bündnisvertrag, der nach knapp vierwöchigen Verhandlungen abgeschlossen wurde, basierte auf dem Stockholmer Bündnis von 1534, allerdings wurden die Handelsartikel in einen eigenen Handelsvertrag ausgegliedert. Die Ratifikation sollte 1541 auf einem Treffen der beiden Könige stattfinden.[69]
Bei dem von den Königen ratifizierten Bündnisvertrag von Brömsebro handelte es sich in weiten Teilen um eine deutsche Übersetzung des Kalmarer Bündnisses. Die Modifikationen erstreckten sich u.a. auf die Bündnisdauer, die von ewigen Zeiten auf 50 Jahre herabgesetzt wurde. Beide Seiten verabredeten die gegenseitige Hilfeleistung im Kriegsfall sowie eine enge Abstimmung ihrer Außen- und Bündnispolitik. Der Widerstandsartikel gegen einen vertragsbrüchigen König (Art. 17) war nun ohne die Möglichkeit seines legalen Einzugs ins Nachbarland abgefasst – die Unionsidee war also seit Stockholm 1534 weiter verblasst.[70]
Für die Schiedsgerichtsbarkeit (Art. 19–20) übernahm der Vertrag von Brömsebro die Bestimmungen des Stockholmer Vertrags von 1534, allerdings sollten die Schiedsrichter künftig mit ausdrücklicher Zustimmung ihrer Könige ernannt werden. Der Rechtsschutz für adelige Exilanten wurde durch eine Ausschlussklausel eingeschränkt, nach der sie sich politisch nicht zum Schaden ihres Heimatlandes betätigen durften. Beide Ergänzungen gingen auf schwedische Wünsche zurück und entsprachen der aristokratiefeindlichen Politik König Gustavs. Schließlich überließ der Vertrag auch die Beurteilung von Vertragsverletzungen und -versäumnissen einem Schiedsausschuss und regelte die Verhängung von Vertragsstrafen und die Festsetzung von Schadenersatz (Art. 26).[72]
Selbst wenn sich das dänisch-schwedische Verhältnis nach Abschluss des Vertrags zunächst verbesserte, vermochte er das tiefe Misstrauen zwischen beiden Ländern nicht auszuräumen. Zu einer gemeinsamen Außenpolitik kam es nicht, und trotz mehrerer Anläufe brachten beide Seiten auch kein Schiedstreffen zustande, um die fortbestehenden oder neu aufgekommenen Misshelligkeiten gemäß den Bündnisbestimmungen beizulegen – mit einer Ausnahme:
Im Mai 1554 trafen sich dänische und schwedische Räte in der schwedischen Grenzfestung Älvsborg, um über Grenzverletzungen und grenzüberschreitende adelige Besitzkonflikte zu verhandeln. Außerdem beschuldigten die Schweden die dänische Seite, einen Adelsaufstand gegen König Gustav unterstützt zu haben. Beide Delegationen waren von ihren Königen zur Durchführung eines Schiedsverfahrens bevollmächtigt, so dass die Dänen, die mit sechs Reichsräten erschienen waren, die Verhandlungen sogleich mit dem Vorschlag eröffneten, man möge einen Schiedsausschuss aus je sechs Räten bilden, um über die adeligen Besitzfragen zu befinden. Die Schweden, die mit zwölf Reichsräten vertreten waren, hatten jedoch eine andere Auffassung vom Verfahren und forderten zunächst Vergleichsverhandlungen, bevor sie sich auf ein Schiedsverfahren einlassen wollten. Die Vergleichsverhandlungen begannen tatsächlich, fuhren jedoch schnell fest, bis der dänische König seine Räte von dem Treffen abberief, mit der – vorgeschobenen? – Begründung, er benötige ihren Rat wegen eines drohenden Krieges in Holstein. Statt förmlicher Abschiede stellten sich beide Seiten unterschiedliche Erklärungen aus, in denen sie ein neues Treffen für das nächste Jahr vorschlugen und sich dazu verpflichteten, die bestehenden Grenzen zu achten. Der Verfahrensstreit spiegelte sich in der schwedischen Forderung, sich vor dem nächsten Treffen auch über die Anzahl der Gesandten zu verständigen. König Gustav war über den Misserfolg sehr verärgert und hatte seither jedes Zutrauen in die Institution der Grenztreffen verloren.[73]
Mit dem Amtsantritt der neuen Könige Frederik II. in Dänemark (reg. 1559–1588) und Erik XIV. in Schweden (reg. 1560–1568) war das Bündnis von Brömsebro de facto bedeutungslos geworden – auch wenn der Vertrag offiziell weiter galt, wurde er von keinem der neuen Könige bei ihrer Thronbesteigung bestätigt, wie es in Art. 17 vorgesehen war. Das dänisch-schwedische Verhältnis verschlechterte sich weiter, seit König Christian III. begonnen hatte, das Drei-Kronenwappen in seinem Siegel zu führen, das von Schweden beansprucht wurde. Erik antwortete mit der Führung des dänischen und norwegischen Wappens. Zusätzlich kollidierten die Interessen beider Länder nun auch im Baltikum, wo beide Könige von der Auflösung des livländischen Ordensstaates zu profitieren suchten und Teile Livlands unter ihre Kontrolle brachten.[74]
Zwar wurden auch in der Phase zugespitzter Beziehungen nach 1560 noch Vorschläge zu einer Revision des Bündnisses von 1541 und seiner Schiedsbestimmungen ausgetauscht: So schlugen die Schweden vor, eine Bußzahlung für den Fall zu vereinbaren, dass eine der beiden Seiten die Grenzverhandlungen ohne Ergebnis verlassen würde (wie die Dänen in Älvsborg 1554), und die Vertretung der Parteien vor dem Schiedsgericht durch Prokuratoren besorgen zu lassen. Die Dänen konterten mit dem Vorschlag, bei Uneinigkeit des Schiedsgremiums drei Obmänner aus seiner Mitte zu bestimmen, um eine Entscheidung herbeizuführen. Beide Vorschläge standen in der skandinavischen Schiedstradition (Varberg 1343, Kalmar 1472–1476, siehe oben) und waren richtungweisend für die Ausgestaltung der Schiedsgerichtsbarkeit in den Friedensschlüssen von Roskilde (1568) und Stettin (1570);[75]
Der Nordische Siebenjährige Krieg (1563–1570) demonstrierte zwar die militärische Überlegenheit Dänemarks über Schweden, doch waren die Dänen nicht stark genug, um Schweden endgültig zu erobern, so dass ihre Feldzüge auf einen bloßen Zermürbungskrieg hinausliefen. Friedensverhandlungen wurden erst eingeleitet, nachdem der friedensunwillige König Erik XIV. von seinen Brüdern Karl und Johan gestürzt worden war.[76]
Im Frieden von Roskilde zwangen die Dänen ihre Verhandlungspartner 1568 zu harten Bedingungen: Die Schweden sollten nicht nur auf alle ihre Eroberungen in Livland und Norwegen verzichten, sondern auch auf ihren Rechtsvorbehalt auf die Insel Gotland. Das Drei-Kronenwappen sollte künftig von beiden Ländern geführt werden, jedoch ohne dass diese territoriale Forderungen daraus ableiteten. Die größte Zumutung für Schweden lag jedoch in den Kriegskosten: Nachdem man den abgesetzten König in der Präambel zum Hauptverantwortlichen für den Krieg erklärt hatte, sollte Schweden als Konsequenz daraus alle dänischen Kriegskosten übernehmen und als Pfand dafür die Festung Älvsborg an Dänemark überlassen. Die genaue Festlegung der dänischen Forderungen wurde einem Schiedsgericht aus sechs ausländischen Fürsten überlassen: Die dänische Seite benannte den Kurfürsten von Sachsen, den Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel sowie den Herzog von Mecklenburg als Urteiler, die schwedische Seite den König von Polen, den Kurfürsten von Brandenburg und den Grafen von Ostfriesland (Art. 13).[77]
Die übrigen Schiedsbestimmungen (Art. 18–20, 22) basierten auf den Verträgen von Stockholm (1534) und Brömsebro (1541). Erstmals seit 1534 wurden die für Streitigkeiten zwischen den Reichen bestellten zwölf Schiedsrichter wieder ausdrücklich als Reichsräte definiert (Art. 18). Für grenzüberschreitende Besitzstreitigkeiten zwischen Privatpersonen sollten dagegen gewöhnliche Adelige (»gode mend«) ausreichen (Art. 19). Neu war die Bestimmung, dass sich die Könige wegen Vertragsbruch auf einen Obmann einigen sollten, falls der Schiedsausschuss nicht mit Mehrheit zu einem Urteil gelangen konnte (Art. 22). Anders als in Stockholm oder Brömsebro wurde der Rechtsschutz für adelige Exilanten wieder aus der zwischenstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit herausgenommen und an die Gerichtsbarkeit des Zufluchtslandes überwiesen (Art. 21).[78]
Mit der Übernahme der Kriegsschuld und der daraus abgeleiteten Kriegskosten hatten die schwedischen Verhandler jedoch ihre Instruktionen überschritten. Nach ihrer Rückkehr verweigerte der neue schwedische König Johan III. (reg. 1569–1592) die Ratifikation des Vertrags, so dass der Krieg 1569 weiterging. Erst auf auswärtigen Druck erklärten sich die Kriegsparteien bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und ihre Gesandten nach Stettin zu entsenden. Dort, auf dem ersten internationalen Friedenskongress der nordeuropäischen Geschichte, wurde ab September 1570 unter Vermittlung von Gesandten des Kaisers, der Könige von Frankreich und Polen sowie des Kurfürsten von Sachsen ein neuer Friedensvertrag ausgehandelt.[79]
Der im Dezember 1570 unterzeichnete Frieden von Stettin übernahm die territorialen Bestimmungen des Roskilder Friedens 1568 im wesentlichen unverändert, begründete sie jedoch anders und formulierte sie nicht mehr als dänisches Diktat, sondern als Vermittlungsergebnis: Die gegenseitige Forderung nach Erstattung der Kriegskosten wurde fallengelassen (Art. 3), die Geldzahlung für die Rückgabe der Festung Älvsborg an Schweden nicht mehr als Abtrag schwedischer Kriegsschulden definiert, sondern als Wiedereinlösung einer dänischen Eroberung (Art. 10–12). Die dänischen Besitzungen in Livland sollten nunmehr nicht direkt, sondern auf dem Umweg über ihren kaiserlichen Lehnsherrn von Schweden an Dänemark zurückfallen (Art. 17). Anders als im Roskildefrieden wurde der Drei-Kronenstreit zum Gegenstand einer internationalen Schiedsabrede (Art. 13), wie bereits zu Beginn des Beitrags ausgeführt.[80]
Die Schiedsgerichtsbarkeit wurde gegenüber dem Roskildefrieden einerseits gestrafft, andererseits genauer spezifiziert (Art. 24–25): So sollten die je sechs Reichsräte bei der Konstitution ihres Schiedsgerichts aus ihrem Untertanen- und Ratseid entlassen und für das Schiedsrichteramt neu vereidigt werden. Der Vertrag von Roskilde hatte nur verlangt, dass sie mit königlicher Zustimmung ernannt würden. Für das Mahn- und Beschwerdeverfahren wurden genaue Fristen und Regelungen festgelegt, welche die Bewilligung eines Grenztreffens zur Abhaltung eines Schiedsgerichts zu einer formellen Vertragspflicht erhoben, falls eine Partei ein solches begehrte. Und schließlich erteilte der Frieden von Stettin den Reichsräten und Untertanen das Widerstandsrecht, falls sich einer der Könige dem Schiedsgericht oder dessen Urteil widersetzen würde. Ebenso wie der Schiedsrichtereid war das Widerstandsrecht ein Ausdruck ratsaristokratischer Auffassungen und schützte die Schiedsrichter vor der Ungnade ihres Königs. Sowohl bei der Mehrheitsentscheidung des Schiedsgremiums als auch bei der Einsetzung eines Obmanns für den Fall seiner Stimmengleichheit handelte es sich dagegen nicht um Neuerungen, sondern um Übernahmen aus den Schiedsbestimmungen von Roskilde 1568.[81]
Die kontinuierliche Entwicklung der Schiedsbestimmungen von den Bündnissen der Jahre 1534 und 1541 über den nicht ratifizierten Friedensvertrag 1568 bis zum Frieden von Stettin 1570 belegt zur Genüge, dass die institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit und ihre Verankerung bei den Reichsräten nicht von den ausländischen Vermittlern des Stettiner Vertrags importiert war, sondern dass es sich um eine zwischen Dänemark und Schweden selbstständig ausgebildete und seit der Unionszeit immer wieder neu belebte Institution handelte, die höchstens in ihren Anfängen auf das römisch-kanonische oder deutsch-rechtliche Schiedswesen zurückgeht. Für den spezifisch innerskandinavischen Charakter dieser Schiedsgerichtsbarkeit spricht auch ein Vergleich mit dem Friedensvertrag zwischen Schweden und Lübeck, der 1570 am selben Tag wie der dänische-schwedische in Stettin geschlossen wurde: Auch er enthielt eine Schiedsabrede, doch sah diese nur eine Instanz vor (ohne Obmann) und definierte die jeweils vier beauftragten Schiedsrichter nicht ausdrücklich als Räte der Parteien.[82]
Die dänisch-schwedischen Schiedsbestimmungen des Stettiner Friedens gaben den Reichsräten beider Seiten wichtige Befugnisse zur Ausgestaltung der zwischenstaatlichen Beziehungen an die Hand. Traditionell gehörte die Außenpolitik in den skandinavischen Reichen zu den königlichen Prärogativen, während sich das Mitspracherecht des Reichsrats auf ein Veto gegen Kriegserklärungen und auf die Steuerbewilligung beschränkte. Indem der Friedensvertrag von Stettin die Gestaltung der nachbarschaftlichen Beziehungen der alleinigen königlichen Verfügungsgewalt entzog, ließ er das Nachbarland zu einem Faktor der dänischen und schwedischen Innenpolitik werden und machte das bilaterale Verhältnis zu einem Schauplatz der konstitutionellen Auseinandersetzung zwischen König und Reichsrat. Die Mitbestimmung des Reichsrats funktionierte jedoch nur in Friedenszeiten, solange beide Seiten auf Grenztreffen miteinander verhandeln konnten. Im Krieg dagegen war der König der alleinige Oberbefehlshaber. Während die beiden Reichsräte in den folgenden Jahrzehnten eine konsequente Friedenspolitik verfolgten, konnten die Könige die außenpolitische Einflussnahme des Rats durch eine bewusste Verschärfung des dänisch-schwedischen Verhältnisses bis zum Heraufbeschwören eines Krieges zurückdrängen. Dies erwies sich besonders dann als kritisch, wenn zwischen König und Reichsrat große Gegensätze herrschten, wie in Dänemark unter König Christian IV. (reg. 1588–1648), der diesen Zusammenhang erkannt und für die Erweiterung seiner Macht zu Lasten des Reichsrats ausgenutzt hat. Ein solches Erklärungsmuster für den Verlauf der dänisch-schwedischen Beziehungen in den ersten Jahrzehnten nach 1600 findet sich bereits 1942 in der Studie von Sven Ulric Palme angedeutet, und ist seither von den dänischen Historikern Leo Tandrup und Knud J.V. Jespersen weiter ausgeführt worden.[83]
5. Das Scheitern der zwischenstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit seit dem Stettiner Frieden
Nach dem Frieden von Stettin 1570 standen sich Dänemark und Schweden erstmals seit der Unionszeit ohne vertraglich vorbehaltene territoriale Forderungen gegenüber. Alle Streitfragen waren durch den Vertrag entweder erledigt oder an eine der beiden Schiedsinstitutionen überwiesen, die mit ihren genauen Regeln bessere Chancen für eine Beilegung der Fragen zu bieten schienen als jemals zuvor. Und dennoch: Trotz – oder vielleicht gerade wegen? – ihrer vertraglich fixierten Mechanismen gelangte die Stettiner Schiedsgerichtsbarkeit in den Jahrzehnten nach 1570 nur ein einziges Mal zur Anwendung, ohne indes ein Ergebnis zu hervorzubringen! Mindestens einer der beiden Könige wollte sich im Zweifelsfall nicht auf ein Urteil der Reichsräte verlassen und hoffte, seine politischen Ziele ohne eine Anwendung der Schiedsgerichtsbarkeit besser erreichen zu können.
Anders als für die interne Schiedsgerichtsbarkeit der Reichsräte hatte der Stettiner Vertrag in der externen Schiedsabrede über die Drei-Kronenfrage sogar schon Termine festgesetzt: Falls sich Dänemark und Schweden bis zum Januar 1572 nicht doch noch untereinander einigen konnten, sollten die Parteien jeweils am 1. Juni der Jahre 1572, 1573 und 1575 in Rostock gegeneinander prozessieren (Art. 4).[84]
Wenn es zunächst nicht zur Anwendung der Stettiner Schiedsbestimmmungen kam, so lag dies nicht allein am Unwillen der Monarchen, sich darauf einzulassen. Vielmehr waren die dänisch-schwedischen Konfliktthemen auch nicht so gelagert, dass sie sich in dem nach Kriegsende herrschenden Klima beiderseitiger Erschöpfung und angesichts der andauernden Verwicklung Schwedens in weitere Kriege gegen Polen und Russland nicht auf anderem Wege hätten regeln lassen. Das gilt sowohl für die fortbestehenden Konflikte um konkurrierende Besitzansprüche in Livland und um den Zugang zum russischen Hafen Narva, als auch für neu aufkommende Misshelligkeiten um die Einlösung Älvsborgs, um die Nordmeerpassage, Zoll- und Handelsfragen sowie um Hoheits- und Steuerrechte in Lappland. Im Ergebnis vollzog sich in den zwei Jahrzehnten nach 1570 eine Art Entspannung zwischen Dänemark und Schweden.[86]
Die Schiedsgerichtsbarkeit spielte auf diesen Treffen keine Rolle. Immerhin drohte der dänische König 1573 mit der Anrufung von Schiedsrichtern, als sich die schwedische Zahlung zur Einlösung Älvsborgs ein weiteres Mal verzögerte. Bei den Schiedsherren, die der König anzurufen gedachte, handelte es sich jedoch nicht um einen Reichsräteausschuss, sondern um die fürstlichen Vermittler des Stettiner Friedens, anders als der Vertrag vorsah.[88]
Erst in den letzten Jahren vor 1600 trübte sich das dänisch-schwedische Verhältnis wieder ein. Den Hintergrund für diese Verschlechterung bildete zum Einen der schwedische Thronstreit zwischen Herzog Karl (ab 1603: König Karl IX., reg. 1603–1611) und dem geflohenen König Sigismund (reg. 1592–1598, gleichzeitig König von Polen 1587–1632), der eine ganze Reihe von schwedischen Adeligen ins dänische Exil trieb, wo sie ihre Aktivitäten gegen Karls usurpatorisches Regime fortsetzten. Auch der dänische König Christian IV. wollte Karl zunächst nicht als schwedischen Herrscher anerkennen und hegte sogar noch die Hoffnung, die Unruhen könnten ihm einen Weg zum Wiedergewinn der schwedischen Krone für Dänemark eröffnen. Zum Anderen hatten die Schweden unter der Herrschaft Karls begonnen, ihre Positionen in Lappland bis zur Eismeerküste auszubauen, nachdem sich Schweden und Russland im Frieden von Teusina (1595) gegenseitig den Zugang zur Eismeerküste zugesichert hatten. Damit gerieten sie in Konflikt mit den norwegischen Amtleuten, die den Anspruch des dänischen Königs auf die ungeschmälerte Herrschaft über die Eismeerküste durchzusetzen hatten. Der Konflikt wurde dadurch begünstigt, dass es in der Finnmark bis dahin keine feste Grenzziehung zwischen Schweden und Norwegen gegeben hatte, und dass die dort lebenden samischen Nomaden üblicherweise von beiden Seiten besteuert wurden.[91]
Es dauerte bis zum Jahr 1600, bis Christian schließlich die Abhaltung eines Reichsrätetreffens bewilligte. Zwar scheiterten die im Februar 1601 am Grenzbach Flabäck geführten Verhandlungen, so dass sich die beiden Seiten keine übereinstimmenden Abschiede ausstellten. Doch vereinbarten sie immerhin ein Schiedsgericht aus je sechs Reichsräten, das Ende September 1601 auf der Grenze in Sjöaryd zusammentreten sollte, um über den Russlandhandel, weitere Zoll- und Handelsfragen sowie über die Ansprüche in Lappland zu befinden. Der schwedische Abschied forderte außerdem eine Schiedsentscheidung in der Drei-Kronenfrage.[93]
Die Schiedsabrede stellte Herzog Karl vor ein Problem, denn ihm standen nicht genügend loyale Reichsräte für ein Schiedsgericht zur Verfügung, und da er sich noch im Mai 1601 in Reval aufhielt, hatte er auch nicht genügend Zeit, um mit Zustimmung der Stände neue Räte zu ernennen. Seine Wünsche, anstatt des Schiedstreffens lieber weiterhin Gesandtschaften auszutauschen oder die Zusammenkunft gegebenenfalls zu verschieben und vor unparteiischen Räten fremder Fürsten stattfinden zu lassen, fanden bei Christian IV. jedoch kein Gehör. Zwar wusste er wahrscheinlich vom bevorstehenden Ausbleiben der Schweden, doch ließ Christian das Treffen trotzdem vorbereiten und erschien im September 1601 demonstrativ mit großem Gefolge am Grenzstein in Sjöaryd, wo er die schwedischen Gesandten mehrere Tage lang erwartete. Nachdem diese tatsächlich nicht eingetroffen waren, ließ Christian im Oktober ein gedrucktes Mandat an die schwedischen Stände verteilen, in dem er das Ausbleiben der Schweden vom Grenztreffen als einen Bruch des Stettiner Friedensvertrags bewertete, ultimativ neue Verhandlungen forderte und im Weigerungsfall einen Krieg androhte. Auf diese Weise wollte er die Autorität des schwedischen Regenten untergraben und an ihm vorbei Verhandlungen mit den schwedischen Ständen erzwingen.[94]
Obwohl Christians Mandat und die schwedische Antwort darauf eine publizistische Fehde zwischen beiden Höfen heraufbeschworen, konnten sich beide Seiten auf ein neues Grenztreffen einigen. Karl bestimmte sofort sechs Gesandte und ernannte sie zu Reichsräten, um ein Schiedsgremium beschicken zu können. Das Treffen zur Osterzeit des Jahres 1602 fuhr schon in den Vorverhandlungen fest, da sich die Dänen nicht zur förmlichen Anerkennung von Karl als schwedischem König bereitfanden und die Annahme der schwedischen Gravamina verweigerten. Auch wenn es dieses Mal gar nicht bis zur Ausfertigung von Abschieden kam, versicherten die Dänen mündlich, den Frieden bis zum nächsten Treffen aufrecht zu erhalten. Das kam Herzog Karl sehr entgegen, denn er wollte zum damaligen Zeitpunkt keinen Krieg mit Dänemark riskieren.[95]
Auf Karls Wunsch stimmte Christian IV. schließlich der Abhaltung eines weiteren Grenztreffens einschließlich eines Schiedsgerichts zu, lehnte jedoch die von Karl vorgeschlagene Vermittlung durch einen ausländischen Fürsten ab. Als Ort und Termin der Zusammenkunft vereinbarte man den Grenzbach Flabäck und den Februar 1603. Zusätzlich zu den sechs Reichsräten für den Schiedsausschuss beorderte Christian diesmal einen siebenten Rat als königlichen Prokurator an die Grenze; außerdem befahl er Rüstungsmaßnahmen für das betreffende Gebiet – vermutlich weniger für einen kriegerischen Überfall, sondern eher als Druckmittel und um das Verhandlungsklima zu vergiften. Seine Instruktion forderte von seinen Räten eine harte Haltung gegenüber Schweden und behielt sich die Appellation gegen einen Schiedsspruch vor einem Obmann vor; inhaltliche Vorgaben in den einzelnen Streitfragen konnte Christian seinen Räten dagegen aus konstitutionellen Gründen nicht machen.[96]
Das Grenztreffen von 1603 zog sich über volle acht Wochen hin, während derer die Verhandlungen auf der Grenzbrücke, weitab von den Unterkünften der Delegierten und bei zum Teil winterlicher Witterung, stattfanden. In den Vorverhandlungen hatten sich Dänen und Schweden auf ein sehr formelles, schriftliches Verhandlungsverfahren geeinigt, bei dem der königlich-dänische Prokurator und die schwedischen Delegierten zunächst je drei Schriftsätze zu jeder einzelnen der vier Kernfragen (Lappland, Livland, Drei Kronen, Zölle) austauschen sollten. Diese Phase dauerte allein drei Wochen. Erst danach nahmen die Delegierten mündliche Beratungen auf, um einzelne Fragen nach Möglichkeit gütlich zu regeln, bevor sie die übrigen Punkte an die Schiedsgerichtsbarkeit überwiesen.[97]
Als nächster Schritt musste nun die Auswahl eines Obmanns erfolgen. Wie nicht anders zu erwarten, konnten sich die beiden Regenten zunächst nicht auf einen solchen Oberschiedsrichter einigen. Christian IV. schlug Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg vor, seinen Schwiegervater, während Karl IX. den hessischen Landgrafen Moritz ins Gespräch brachte. Da sich das dänisch-schwedische Verhältnis unterdessen weiter verschlechterte, zeigte sich Christian nur wenig an einer Schiedsentscheidung interessiert und wies 1605 die schwedische Forderung nach einem Grenztreffen ab, so dass die Kontakte zwischen beiden Parteien von 1606 bis 1607 sogar völlig abbrachen.[99]
Seit 1603 forderte Christian von seinem Reichsrat die Zustimmung zu einem Präventivkrieg gegen Schweden, scheiterte jedoch viermal an der Reichsratsmehrheit (1603, 1604, 1609, 1610). Erst 1611 konnte sich Christian mit seiner Kriegsabsicht gegenüber dem Reichsrat durchsetzen und erzielte damit einen wichtigen Erfolg über die Friedenspolitik, die der dänische Reichsrat seit dem Stettiner Friedensvertrag von 1570 verfolgte.[101]
Im »Kalmarkrieg« (1611–1613) konnten die Dänen wiederum wichtige schwedische Festungen in ihre Hand bringen, doch erwies sich Schweden erneut als zu groß für eine dänische Eroberung, ähnlich wie im Nordischen Siebenjährigen Krieg.[102]
In den Jahren nach 1613 zeigten sich die dänisch-schwedischen Beziehungen aus Mangel an Konfliktthemen fast orientierungslos, ohne dass sich deshalb ein partnerschaftliches Verhältnis einstellen wollte. Das erste Grenztreffen nach dem Krieg fand kurz nach der Bezahlung der letzten Rate für Älvsborg 1619 in Sjöaryd statt. Außer den immer aufs Neue wiederkehrenden Zollfragen diskutierten die delegierten Reichsräte ein schwedisches Bündnisprojekt, das Dänemark und Schweden gegen Polen und andere katholische Mächte, mindestens aber zur gemeinsamen Verteidigung zusammenführen sollte, doch wollte sich der dänische König nicht darauf einlassen. Trotz dieses schwedischen Misserfolgs kamen die beiden Könige Christian IV. und Gustav Adolf (reg. 1611–1632) im Anschluss an das Grenztreffen auf dänischem Boden zusammen und verbrachten mehrere Tage gemeinsam unter großen Festlichkeiten und in scheinbarer Harmonie. Zu ernsthaften politischen Verhandlungen kam es dabei offenbar nicht.[104]
Nachdem sich die 1619 nur beiläufig berührten Zollstreitigkeiten in den folgenden Jahren verschärft hatten, verabredete man für Mai 1624 ein neues Grenztreffen in Sjöaryd.[105]
Schon das Scheitern des Schiedsprozesses in den Jahren nach 1603 und erst recht die Ablehnung der dänischen Schiedsbegehren beim Grenztreffen 1624 zeigen deutlich, dass sich die Institution der Schiedsgerichtsbarkeit zwischen Dänemark und Schweden überholt hatte. Mit den Schiedsbestimmungen des Friedens von Stettin 1570 wurde auch deren Garantie für den weitreichenden Einfluss der Reichsräte auf die dänisch-schwedischen Beziehungen hinfällig. Anders als in der Unionszeit und in den ersten Jahrzehnten danach waren die adeligen Reichsräte im 17. Jahrhundert keine unabhängigen Magnaten mehr, die eine Mittlerrolle zwischen den Reichen und ihren Monarchen hätten spielen können. Im gleichen Maße, wie sich das alte, aus der Unionszeit herrührende skandinavische Gemeinschaftsgefühl aufgebraucht hatte, verloren die dänisch-schwedischen Beziehungen ihren besonderen Charakter und glichen sich an den diplomatischen Standard zwischen anderen souveränen Nationen an: Seit 1621 tauschten Dänemark und Schweden ständige diplomatische Vertreter untereinander aus.[111]
Der Rückgang der zwischenstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit in der Frühen Neuzeit wird in der Literatur gern mit dem aufkommenden Souveränitätsanspruch des frühmodernen Staates begründet[114]
ABKÜRZUNGEN UND LITERATUR
AFZELIUS, Adam, u.a. (Hg.), Diplomatarium Danicum, II. Række (1250–1339), Bd. 3 (1281–1290), København 1939; Bd. 6–8 (1306–1322), København 1948–1956.
AHNLUND, Nils, Den svenska utrikespolitikens historia I:1. Tiden före 1560, Stockholm 1956.
ALBRECTSEN, Esben, 700–1523, in: Ders. / Karl-Erik FRANDSEN / Gunner LIND, Konger og krige 700–1648, København 2001 (Dansk udenrigspolitiks historie 1), S. 10–215.
AMIRA, Karl von, Germanisches Recht. 4. Auflage, ergänzt von August ECKHARDT, Bd. 1–2, Berlin 1960–1967 (Grundriss der germanischen Philologie 5 / 1–2).
ANDERSEN, Aage, u.a. (Hg.), Diplomatarium Danicum, IV. Række (1376–1412), Bd. 6 (1396–1398), København 1998.
BEHRENDS, Okko, u.a. (Hg.), Corpus Iuris Civilis. Text und Übersetzung. Auf der Grundlage der von Theodor MOMMSEN und Paul KRÜGER besorgten Textausgaben, Bd. I–[IV], Heidelberg 1990–[2005].
BJERG, Hans Christian / FRANTZEN, Ole L., Danmark i krig, København 2005.
BUSCH, Michael, Krieg – Krise – Absolutismus. Die Entstehung königlicher Alleinherrschaft in Dänemark und Schweden. Ein Vergleich, in: Bernd WEGNER (Hg.), Wie Kriege enden. Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart, Paderborn 2002, S. 93–120.
CHRISTENSEN, C.A., u.a. (Hg.), Diplomatarium Danicum, III. Række (1340–1375), Bd. 1 (1340–1343), København 1958.
Dipl. Dan. II siehe AFZELIUS; Dipl. Dan. III siehe CHRISTENSEN; Dipl. Dan. IV siehe ANDERSEN.
Dipl. Flensb. I siehe SEJDELIN.
DNT siehe LAURSEN.
DUCHHARDT, Heinz, »Friedensvermittlung« im Völkerrecht des 17. und 18. Jahrhunderts. Von Grotius zu Vattel, in: Ders., Studien zur Friedensvermittlung in der Frühen Neuzeit, Mainz 1979 (Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft 6), S. 89–117.
DUCHHARDT, Heinz, Europa am Vorabend der Moderne 1650–1800, Stuttgart 2003 (Handbuch der Geschichte Europas 6).
DUCHHARDT, Heinz / PETERS, Martin (Hg.), Europäische Friedensverträge der Vormoderne – online, Mainz [ohne Jahr]. URL: https://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009).
ENGEL, Josef, Von der spätmittelalterlichen respublica christiana zum Mächte-Europa der Neuzeit, in: Theodor SCHIEDER (Hg.), Handbuch der europäischen Geschichte, Bd. 3 Die Entstehung des neuzeitlichen Europa, Stuttgart 1971, S. 1–443.
ERSLEV, Kristian, Dronning Margarethe og Kalmarunionens Grundlæggelse, København 1882.
ERSLEV, Kristian, Erik af Pommern, hans Kamp for Sønderjylland og Kalmarunionens Opløsning, København 1901.
FEINE, Hans Erich, Kirchliche Rechtsgeschichte, Bd. I Die katholische Kirche, Köln 41964.
FRANDSEN, Karl-Erik, 1523–1588, in: Esben ALBRECTSEN / Ders. / Gunner LIND, Konger og krige 700–1648, København 2001 (Dansk udenrigspolitiks historie 1), S. 216–339.
FRIEDBERG, Emil (Hg.), Corpus Iuris Canonici, Bd. I–II, 2 Leipzig 1879–1881.
Hanserecesse siehe KOPPMANN, von der ROPP.
HELLE, Knut, Towards nationally organised systems of government, (a) Introductory survey, in: Ders. (Hg.), The Cambridge History of Scandinavia, Vol. I Prehistory to 1520, Cambridge 2003, S. 345-352.
HOFFMANN, Erich, Konflikte mit auswärtigen Mächten, dargestellt am Beispiel der Auseinandersetzungen mit Waldemar IV., in: Jörgen BRACKER (Hg.), Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos. Ausstellungskatalog, Bd. I, Hamburg 1989, S. 634–638.
JANSSEN, Wilhelm, Die Anfänge des modernen Völkerrechts und der neuzeitlichen Diplomatie. Ein Forschungsbericht, Stuttgart 1965.
JENSEN, Frede P., Danmarks konflikt med Sverige 1563–1570, København 1982 (Skrifter udgivet af det Historiske Institut ved Københavns Universitet 12).
JESPERSEN, Knud J.V., Rivalry Without Victory. Denmark, Sweden and the Struggle for the Baltic, 1500–1720, in: Göran RYSTAD / Klaus-Richard BÖHME / Wilhelm M. CARLGREN (Hg.), In Quest of Trade and Security. The Baltic in Power Politics 1500–1990, Bd. I, Lund 1994, S. 137–176.
JØRGENSEN, Poul Johannes, Dansk Retshistorie, København 21947.
KAMPMANN, Christoph, Arbiter und Friedensstiftung. Die Auseinandersetzung um den politischen Schiedsrichter im Europa der Frühen Neuzeit, Paderborn 2001 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte NF 21).
KOPPMANN, Karl (Bearb.), Hanserecesse. [I. Abtheilung:] Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256–1430, Bd. 6 (1411–1418), Leipzig 1889.
LAMMASCH, Heinrich, Die Lehre von der Schiedsgerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange, Stuttgart 1913–1914 (Handbuch des Völkerrechts III 1).
LANDBERG, Georg, De nordiska rikena under Brömsebroförbundet, Uppsala 1925.
LANDBERG, Georg, Johan Gyllenstiernas nordiska förbundspolitik i belysning av den skandinaviska diplomatiens traditioner, Uppsala 1935 (Uppsala universitets årsskrift 1935, 10).
LAURSEN, Laurs R. (Hg.), Danmark-Norges Traktater 1523–1750 med dertil hørende Aktstykker, Bd. I–V (1523–1664), København 1907–1920.
LIND, Gunner, 1523–1588, in: Esben ALBRECTSEN / Karl-Erik FRANDSEN / Ders., Konger og krige 700–1648, København 2001 (Dansk udenrigspolitiks historie 1), S. 340–469.
LINGENS, Karl-Heinz, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Jus publicum Europaeum 1648–1794, Berlin 1988 (Schriften zum Völkerrecht 87).
MAURER, Konrad, Vorlesungen über altnordische Rechtsgeschichte, Bd. I:2 Altnorwegisches Gerichtswesen, Leipzig 1907.
NIELSEN, Herluf, u.a., Art. »Rigsråd«, in: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 14 (1969), Sp. 220–234.
NORTH, Michael, Europa expandiert 1250–1500, Stuttgart 2007 (Handbuch der Geschichte Europas 4).
OLESEN, Jens E., Rigsråd, Kongemagt, Union. Studier over det danske rigsråd og den nordiske kongemagts politik 1434–1449, Aarhus 1980 (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie 36).
OLESEN, Jens E., Unionskrige og Stændersamfund. Bidrag til Nordens historie i Kristian I.’s regeringstid 1450–1481, Aarhus 1983 (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie 40).
OLESEN, Jens E., Inter-Scandinavian relations, in: Knut HELLE (Hg.), The Cambridge History of Scandinavia, Vol. I Prehistory to 1520, Cambridge 2003, S. 710–770.
PALME, Sven Ulric, Sverige och Danmark 1596–1611, Uppsala 1942.
RENNEFAHRT, Hermann, Beitrag zu der Frage der Herkunft des Schiedsgerichtswesens besonders nach westschweizerischen Quellen, in: Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte 16 (1958), S. 5–55.
RENNEFAHRT, Hermann, Nachlese zu der Frage der Herkunft des Schiedsgerichtswesens, in: Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte 17 (1959), S. 196–218.
ROPP, Goswin Frhr. von der (Bearb.), Hanserecesse. II. Abtheilung: Hanserecesse von 1431–1476, Bd. 1 (1431–1436), Leipzig 1876.
RYDBERG, O.S. (Hg.), Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar, Bd. III–VI:1:1 (1409–1648), Stockholm 1888–1915.
RYDMAN LANGSETH, Sissel / LIEDGREN, Jan, Art. »Voldgift«, in: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 20 (1976), Sp. 226–230.
SCHÜCK, Herman, The political system, in: Knut HELLE (Hg.), The Cambridge History of Scandinavia, Vol. I Prehistory to 1520, Cambridge 2003, S. 679–709.
SEJDELIN, H.C.P. (Hg.), Diplomatarium Flensborgense. Samling af Aktstykker til Staden Flensborgs Historie indtil Aaret 1559, Bd. I, Kjøbenhavn 1865.
SELLERT, Wolfgang, Art. »Schiedsgericht«, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 4 (1990), Sp. 1386–1393.
ST siehe RYDBERG.
SUNDBERG, Ulf, Svenska freder och stillestånd 1249–1814, Hargshamn 1997.
TANDRUP, Leo, Mod triumf eller tragedie. En politisk-diplomatisk studie over forløbet af den dansk-svenske magtkamp fra Kalmarkrigen til Kejserkrigen, Bd. I–II, Aarhus 1979 (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie 35).
THAM, Wilhelm, Den svenska utrikespolitikens historia I:2. 1560–1648, Stockholm 1960.
TRUSEN, Winfried, Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland, Wiesbaden 1962 (Recht und Geschichte 1).
WEITZEL, J., Art. »Schiedsgericht«, in: Lexikon des Mittelalters 7 (1995), Sp. 1454–1455.
WESTLING, Fredrik, Sveriges förhållande till Danmark från freden i Stettin till Fredrik II:s död (1571–1588), in: [Svensk] Historisk Tidskrift 39 (1919), S. 55–102, 123–154.
ANMERKUNGEN
[*] Dr. Bengt Büttner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am DFG-geförderten Projekt »Europäische Friedensverträge der Vormoderne - online« (Institut für Europäische Geschichte, Mainz)
[1] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13 (Dänemark, Schweden), in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in DNT II, Nr. 13 A, S. 233–260, vgl. LAURSEN, ebd., S. 213–233, THAM, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 49–51, JENSEN, Danmarks konflikt 1982, S. 326–331, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 209–211, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 315–317. – Die für diesen Beitrag einschlägigen Verträge und Abschiede liegen gedruckt vor in Sverges Traktater (ST) (bis 1648), im Diplomatarium Danicum (Dipl. Dan.) (bis 1412) sowie in Danmark-Norges Traktater (DNT) (ab 1523). Der vorliegende Beitrag zitiert die jeweils behandelten Dokumente in der Regel nur nach einem dieser Werke.
[2] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13 (Dänemark, Schweden), in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Art. 4 gedruckt in DNT II, S. 237–242.
[3] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13 (Dänemark, Schweden), in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Art. 24 gedruckt in DNT II, S. 255–257. Den Unterschied zwischen isolierter und institutioneller Schiedsgerichtsbarkeit definieren LAMMASCH, Lehre 1913–1914, S. 9, sowie LINGENS, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit 1988, S. 33f.
[4] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13 (Dänemark, Schweden), in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Art. 25 gedruckt in DNT II, S. 257.
[5] Dipl. Dan. II:3, Nr. 154–155 (1285), S. 153–155, vgl. AHNLUND, Sv. utrikespolitikens historia 1956, S. 42
[6] Zur Ausbildung staatlicher Strukturen in den skandinavischen Reichen vgl. zusammenfassend HELLE, Systems 2003.
[7] Dipl. Dan. II:6, Nr. 86 (1307), S. 74f., Nr. 482 (1312), S. 392, II:8, Nr. 59 (1318), S. 53–56. Die Schiedsabrede im Waffenstillstand von Berga 1308 (Dipl. Dan. II:6, Nr. 125, S. 109f.) nennt keine Anzahl für die Schiedsrichter. Vgl. ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S. 104–107, NORTH, Handbuch 2007, S. 272.
[8] Dipl. Dan. II:7, Nr. 52 (1313), S. 45f.
[9] Vgl. AHNLUND, Sv. utrikespolitikens historia 1956, S. 42f.
[10] Vgl. SELLERT, Schiedsgericht 1990, Sp. 1386f., TRUSEN, Anfänge 1962, S. 152–154, 158, RYDMAN LANGSETH / LIEDGREN, Voldgift 1976, Sp. 225f., KAMPMANN, Arbiter 2001, S. 27f.
[11] Zu den paritätisch besetzten Schiedsausschüssen der fränkischen »Marchgerichtsbarkeit« in der Schweiz, in Frankreich und den Niederlanden vgl. RENNEFAHRT, Beitrag 1958, S. 25–33, 49. – Zu den paritätisch besetzten Auschüssen des skandinavischen »skiladómr« vgl. AMIRA, Germanisches Recht 1960–1967, Bd. 2, S. 160. RENNEFAHRT möchte deshalb einen skandinavischen Ursprung für die kontinentale Marchgerichtsbarkeit annehmen, vgl. RENNEFAHRT, Nachlese 1959, S. 212–216.
[12] D IV.8.51, ed. BEHRENDS, Corpus 1990–2005, Bd. I, S. 458, vgl. RENNEFAHRT, Beitrag 1958, S. 48.
[13] X 1.43.1, 12, ed. FRIEDBERG, Corpus 1879–1881, Bd. II, Sp. 220, 237f., vgl. FEINE, Rechtsgeschichte 1964, S. 434f.
[14] Dipl. Dan. II:3, Nr. 154 (1285), S. 153f. – Zum Vordringen des Mehrheitsprinzips in schweizerischen Schiedsverfahren vgl. TRUSEN, Anfänge 1962, S. 157.
[15] Zum Unterschied zwischen beauftragten und erbetenen Schiedsrichtern vgl. LINGENS, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit 1988, S. 57–80.
[16] Beispiele für eine hansische Vermittlertätigkeit zwischen Dänemark und den Grafen von Holstein oder dem Deutschen Orden im 15. Jh. gibt ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S. 138, 143f., 147, 152, 159f. – Zum Verhältnis der Hanse zu Dänemark vgl. exemplarisch HOFFMANN, Konflikte 1989.
[17] Ebd., S. 138, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 20, AHNLUND, Sv. utrikespolitikens historia 1956, S. 43.
[18] Dipl. Dan. III:1, Nr. 195 (1341), S. 190–192, vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 7.
[19] Dipl. Dan. III:1, Nr. 343 (1343), S. 329–333, Nr. 384–386 (1343), S. 371–384, vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 7f.
[20] Vgl. AMIRA, Germanisches Recht 1960–1967, Bd. 2, S. 160, MAURER, Vorlesungen 1907, S. 181.
[21] Vgl. NIELSEN, Rigsråd 1969, NORTH, Handbuch 2007, S. 280–282, speziell zu Dänemark JØRGENSEN, Retshistorie 1947, S. 489–497.
[22] Beispiele für die grenzüberschreitende Verflechtung der Ratsfamilien geben OLESEN, Inter-Scandinavian relations 2003, S. 710f., OLESEN, Rigsråd, Kongemagt, Union 1980, S. 10–15, ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S. 180. Zu den Unionssympathien der schwedischen Ratsaristokratie im 16. Jh. vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 50f.
[23] Dipl. Dan. IV:6, Nr. 344–345 (1397), S. 274–277, vgl. AHNLUND, Sv. utrikespolitikens historia 1956, S. 53. Zum Verhältnis der beiden Dokumente zueinander vgl. zusammenfassend SCHÜCK, Political system 2003, S. 683–685.
[24] Vgl. OLESEN, Rigsråd, Kongemagt, Union 1980, S. 2, SCHÜCK, Political system 2003, S. 691f., 694.
[25] ST III, Nr. 468 (1434), 469 (1435), S. 124–130, vgl. OLESEN, Rigsråd, Kongemagt, Union 1980, S. 21–28, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 112–115.
[26] ST III, Nr. 473a–b (1435), S. 147–156, vgl. OLESEN, Rigsråd, Kongemagt, Union 1980, S. 31–36, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 116f. – Die Insel Gotland war 1361 von König Valdemar Atterdag für Dänemark erobert worden, vgl. ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S.116–118.
[27] ST III, Nr. 474 (1436), S. 156–159, vgl. OLESEN, Rigsråd, Kongemagt, Union 1980, S. 47f., SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 118f.
[28] Hanserecesse II:1, Nr. 603–608 (1436), S. 535–551, ST III, Nr. 475 (1436), S. 160–165, vgl. OLESEN, Rigsråd, Kongemagt, Union 1980, S. 50–58, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 120f., SCHÜCK, Political system 2003, S. 693. – Dass das Vergleichsinstrument die hansischen Sendboten zu Unrecht als »waldgiftesmæn« bezeichne (PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 10), ist so nicht zutreffend, denn die Bezeichnung bezieht sich auf alle Aussteller der Vergleichsurkunde gleichermaßen, also auf die dänischen Reichsräte ebenso wie die hansischen Sendboten. Tatsächlich aber verkündeten diese einen Vergleich, kein Schiedsurteil, vgl. AHNLUND, Sv. utrikespolitikens historia 1956, S. 44.
[29] Hanserecesse II:1, Nr. 603 (1436, Bericht der hansischen Sendboten), § 8, S. 537.
[30] Vgl. ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S. 156.
[31] Vgl. SCHÜCK, Political system 2003, S. 694f.
[32] Vgl. ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S. 173–181, 196–205, NORTH, Handbuch 2007, S. 277, 279f.
[33] ST III 488c–d (1449), S. 217–221, vgl. OLESEN, Rigsråd, Kongemagt, Union 1980, S. 415–417, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 127–128.
[34] ST III, Nr. 490–491 (1450), vgl. OLESEN, Rigsråd, Kongemagt, Union 1980, S. 418–420, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 130f., ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S. 172, SCHÜCK, Political system 2003, S. 695.
[35] Vgl. SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 132, ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S. 174.
[36] Vgl. ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S. 177–181, BJERG / FRANTZEN, Danmark i krig 2005, S. 21–26.
[37] ST III, Nr. 516 (1472), S. 318–324, Nr. 518 (1473), S. 327–329, Nr. 519 (1474), S. 331–334, Nr. 522a (1476), S. 340–342, vgl. OLESEN, Unionskrige og Stændersamfund 1983, S. 353–387, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 154, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 10f.
[38] Vgl. AHNLUND, Sv. utrikespolitikens historia 1956, S. 44f., 54.
[39] Vgl. OLESEN, Unionskrige og Stændersamfund 1983, S. 381, AHNLUND, Sv. utrikespolitikens historia 1956, S. 45.
[40] ST III, Bihang XV (1483), S. 678–686, Nr. 529 (1483), S. 371–385, zu den jährlichen Treffen siehe S. 685f., 383, vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 11, SCHÜCK, Political system 2003, S. 696.
[41] ST III, Nr. 569a (1505), S. 506–511, vgl. SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 168f., AHNLUND, Sv. utrikespolitikens historia 1956, S. 45, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 12 Anm.
[42] ST III, Nr. 571 (1508), S. 535f., Nr. 580 (1512), S. 570–573, Nr. 583 (1515), S. 585–587, Nr. 586a–b (1518), S. 590–594, vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 12 Anm.
[43] ST III, Nr. 572 (1508), S. 538–541, Nr. 582 (1513), S. 581–584. Zum Treffen in Varberg 1508 waren ursprünglich 12 schwedische Räte bevollmächtigt worden (ST III zu Nr. 572, S. 542). Von diesen 12 nahmen dann 10 tatsächlich an der Zusammenkunft teil; für die beiden fehlenden wurde offenbar nur ein Ersatzmann gestellt.
[44] ST III, Nr. 441 (1411), S. 9–14, vgl. ERSLEV, Dronning Margarethe 1882, S. 402, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 93f.
[45] Dipl. Flensb. I, Nr. 66 (1413), S. 206–221, vgl. ERSLEV, Erik af Pommern 1901, S. 9–12, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 95f.
[46] ST III, Nr. 449 (1417), S. 31–35, vgl. ERSLEV, Erik af Pommern 1901, S. 45f. Dass es sich bei den »bornen heren« tatsächlich um Fürsten handelt, ergibt sich aus der Aufzählung der von beiden Seiten nominierten Fürsten in einer zweiten Ausfertigung, gedruckt in Hanserecesse I:6, Nr. 504 (1417), S. 491.
[47] Vgl. ERSLEV, Erik af Pommern 1901, S. 61–63.
[48] ST III, Nr. 457 (1424), vgl. ERSLEV, Erik af Pommern 1901, S. 85–88, 103f.
[49] Dipl. Flensb. I, Nr. 92 (1425), S. 375–377, vgl. ERSLEV, Erik af Pommern 1901, S. 201f.
[50] ST III, Nr. 465 (1432), S. 110–113, vgl. SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 104f., ALBRECTSEN, Konger og krige 2001, S. 154.
[51] Hanserecesse II:1, Nr. 371 (1434), S. 266–268, ST III, Nr. 470 (1435), S. 135–140, Nr. 472 (1435), S. 143–146, vgl. ERSLEV, Erik af Pommern 1901, S. 340f., 345f, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 106–108.
[52] Unionsvertrag von Rendsburg 1533 XII 5, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in DNT I, Nr. 33, S. 152–171, vgl. FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 235f.
[53] DNT III, Nr. 5 (1593), S. 68–70, Nr. 18 (1616), S. 317f. – Unionsvertrag von Kopenhagen 1623 VI 19, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in: DNT III, Nr. 33, S. 551–558.
[54] ST III, Nr. 500 (1458), S. 269–271, Nr. 502 (1459), S. 272–274, Nr. 507 (1462), S. 280–283.
[55] Vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 4f., LANDBERG, Gyllenstiernas nordiska förbundspolitik 1935, S. 14f., PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 50, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 219, 245f.
[56] Vgl. LAURSEN, in: DNT I, S. 15f., LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 7f., SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 193f., FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 246–248.
[57] Rezess von Malmö 1524 IX 1, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 3 A, S. 16–22, vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 8f., SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 195–197, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 248, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 13.
[58] Vgl. SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 197, LAURSEN, in: DNT I, S. 74f., LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 10f.
[59] Rezess von Lödöse 1528 VIII 21, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 16, S. 76–78, vgl. LAURSEN, ebd. S. 75, LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 11f.
[60] Rezess von Varberg 1530 VIII 8, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 20, S. 89–92, vgl. LAURSEN, ebd. S. 88f., LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 13, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 12f., SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 198.
[61] Vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 14, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 258–260, BJERG / FRANTZEN, Danmark i krig 2005, S. 39.
[62] DNT I, Nr. 34 A (1534), S. 175–185, vgl. LAURSEN, ebd. S. 171f., FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 267–269.
[63] Vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 16f., PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 14f.
[64] DNT I, Nr. 34 A (1534), Art. 17, S. 181, vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 16f.
[65] Vgl. LAURSEN, in: DNT I, S. 172–174, 307–309, LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 18–21, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 278.
[66] DNT I, Nr. 46 (1536), S. 248–250, Nr. 50 (1537), S. 274–276, vgl. LAURSEN, ebd. S. 274, 309, LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 22f., JENSEN, Danmarks konflikt 1982, S. 21, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 278.
[67] Vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 22–25, JENSEN, Danmarks konflikt 1982, S. 22, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 282f.
[68] Vgl. LAURSEN, in: DNT I, S. 310f., FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 279.
[69] DNT I, Nr. 57 A (1540, Bündnisvertrag), S. 348–384, Nr. 55 B (1540, Handelsvertrag), S. 312–317, vgl. FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 279f., LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 23.
[70] Bündnis von Brömsebro 1541 IX 14 oder 15, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 57 A, S. 348–384 (im Paralleldruck zum Kalmarbündnis von 1540), vgl. LAURSEN, ebd. S. 341–347, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 280f., LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 24–30.
[71] Bündnis von Brömsebro 1541 IX 14 oder 15, in. DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Art. 22 gedruckt in DNT I, Nr. 57 A, S. 373, vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 29, gegen z.B. FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 280.
[72] Bündnis von Brömsebro 1541 IX 14 oder 15, in. DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Art. 26 gedruckt in DNT I, Nr. 57 A, S. 376–381, nach der Vorlage des Kalmarbündnisses (Art. 30). Nur das Kalmarbündnis beschreibt den Schiedsausschuss als Gremium aus jeweils 12 Schiedsherren beider Seiten (ebd., S. 379f.), vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 15f.
[73] Vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 218–223, 227, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 15–18, JENSEN, Danmarks konflikt 1982, S. 24.
[74] Vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 234–248, 259f., 296, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 72f., JENSEN, Danmarks konflikt 1982, S. 25–27, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 293f., 299–302.
[75] Vgl. LANDBERG, Brömsebroförbundet 1925, S. 299–301, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 18f.
[76] Vgl. FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 308–312, JENSEN, Danmarks konflikt 1982, bes. S. 252f., 332–341, 342–348 (dt. Zusammenfassung), SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 203, 207.
[77] Friedensvertrag von Roskilde 1568 XI 18, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in: DNT II, Nr. 10, S. 176–185, vgl. LAURSEN, ebd. S. 170f., JENSEN, Danmarks konflikt 1982, S. 262–266, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 207f., FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 312f.
[78] Vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 19, JENSEN, Danmarks konflikt 1982, S. 266.
[79] Vgl. LAURSEN, in: DNT II, S. 172f., 219–232, JENSEN, Danmarks konflikt 1982, S. 313–320, 326–330, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 314–316.
[80] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13 (Dänemark, Schweden), in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in: DNT II, Nr. 13 A, S. 233–260, vgl. JENSEN, Danmarks konflikt 1982, S. 331, SUNDBERG, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 209–211, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 316f.
[81] Vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 22–29. Dass der Obmann bereits 1568 im Roskildevertrag vorkommt (DNT II, Nr. 10, Art. 22, S. 183f.), ist PALME offenbar entgangen, vgl. ebd., S. 23f.
[82] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13 (Lübeck, Schweden), in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in ST IV, Nr. 61, S. 411–424, hier S. 411f., vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 33.
[83] Vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 619, TANDRUP, Mod triumf eller tragedie 1979, bes. Bd. II, S. 517–522, JESPERSEN, Rivalry 1994, S. 144–148. Zu den außenpolitischen Befugnissen der Reichsräte in der Frühen Neuzeit in Dänemark JØRGENSEN, Retshistorie 1947, S. 332f., 496., in Schweden THAM, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 9–11, 146.
[84] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13 (Dänemark, Schweden), in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Art. 4 gedruckt in DNT II, S. 237–242.
[85] DNT II, Nr. 17 (1572), S. 298–300, vgl. LAURSEN, ebd. S. 297f., 347f., WESTLING, Sveriges förhållande 1919, S. 68–70, 81, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 78, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 325.
[86] Vgl. WESTLING, Sveriges förhållande 1919, S. 150–154, LANDBERG, Gyllenstiernas nordiska förbundspolitik 1935, S. 20, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 34f., 99–101, FRANDSEN, Konger og krige 2001, S. 325, LIND, ebd. S. 370.
[87] Abschied von Ulfsbäck 1575 VI 1, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in DNT II, Nr. 22 A–B, S. 354–359, vgl. LAURSEN, ebd. S. 351–354, WESTLING, Sveriges förhållande 1919, S. 98–101, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 78 – Abschied von Ulfsbäck 1580 X 12, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in DNT II, Nr. 28 A–B, S. 505–512, vgl. LAURSEN, ebd. S. 501–505, WESTLING, Sveriges förhållande 1919, S. 142–148, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 78–80 – Abschied von Flabäck 1591 VIII 17, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in DNT III, Nr. 4 A–B, S. 60–67, vgl. LAURSEN, ebd. S. 54–59, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 81–87.
[88] Vgl. LAURSEN, in: DNT II, S. 349f., WESTLING, Sveriges förhållande 1919, S. 80.
[89] Vgl. LAURSEN, in: DNT II, S. 501f., WESTLING, Sveriges förhållande 1919, S. 142f., PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 78f.
[90] Vgl. LAURSEN, in: DNT II, S. 54, 59, WESTLING, Sveriges förhållande 1919, S. 153.
[91] Vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 101f., 143, 183–186, LIND, Konger og krige 2001, S. 378f.
[92] Vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 114–116, 159, 170f., 176f., 194–197.
[93] DNT III, Nr. 8 A–B (1601), S. 107–122, vgl. LAURSEN, ebd. S. 93–107, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 222–251, LIND, Konger og krige 2001, S. 379.
[94] Vgl. LAURSEN, in: DNT III, S. 176f., PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 255–270.
[95] Vgl. LAURSEN, in: DNT III, S. 177f., PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 287–291, 303f., 322–335, 352–354.
[96] Ebd., S. 383–390, 395–403, 318.
[97] Vgl. LAURSEN, in: DNT III, S. 181–186, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 406–418, 431f., LIND, Konger og krige 2001, S. 379f.
[98] DNT III, Nr. 12 A (1603), S. 188–196, vgl. PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 454–463, LIND, Konger og krige 2001, S. 380. – Die dänischen Urteile sind gedruckt in DNT III, Nr. 12 D, S. 199–245, die schwedischen in ST V:1, S. 135–149.
[99] Vgl. LAURSEN, in: DNT III, S. 186f., PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 468–478, 486–494, 516f.
[100] Vgl. LAURSEN, in: DNT III, S. 187f., PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 519–533, LIND, Konger og krige 2001, S. 380.
[101] Vgl. LIND, Konger og krige 2001, S. 380–383, PALME, Sverige och Danmark 1942, S. 475f., 480–486, 537–542, 589–592, 616–619.
[102] Vgl. LIND, Konger og krige 2001, S. 383f., JESPERSEN, Rivalry 1994, S. 148, TANDRUP, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 187–194.
[103] Friedensvertrag von Knäred 1613 I 20, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in DNT III, Nr. 17 A, S. 303–311, vgl. LAURSEN, ebd. S. 288–302, LIND, Konger og krige 2001, S. 384f., TANDRUP, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 197–223.
[104] DNT III, Nr. 20 (1619), S. 349f., vgl. LAURSEN, ebd. S. 344–349, TANDRUP, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 322–343, LIND, Konger og krige 2001, S. 396f., 402.
[105] Vgl. LIND, Konger og krige 2001, S. 397, LAURSEN, in: DNT III, S. 558–576.
[106] Vgl. TANDRUP, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. II, S. 268, 289, 291.
[107] Ebd., S. 267–274, 283–285.
[108] Ebd., S. 294f., 300–303, 306, 308–311, 315, 327f.
[109] Ebd., S. 306f., 322f., 325, 332f.
[110] DNT III, Nr. 34 (1624), S. 576–585, vgl. TANDRUP, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. II, S. 330–338.
[111] Vgl. TANDRUP, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. II, 347–350, LIND, Konger og krige 2001, S. 398, 393.
[112] Friedensvertrag von Brömsebro 1645 VIII 13, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in DNT IV, Nr. 34 C, S. 437–463, zum Stettiner Frieden Art. 32, S. 458 – Friedensvertrag von Roskilde 1658 II 26, in: DUCHHARDT / PETERS, www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21. April 2009). Gedruckt in DNT V, Nr. 13 A, S. 228–240, zum Stettiner Frieden Art. 21, S. 238f.
[113] Vgl. DUCHHARDT, Handbuch 2003, S. 283f., 290f., BUSCH, Krieg – Krise – Absolutismus 2002, bes. S. 98–106, 112–120.
[114] Zum Beispiel bei JANSSEN, Anfänge 1965, S. 35, ENGEL, Handbuch 1971, S. 374f., DUCHHARDT, Friedensvermittlung 1979, S. 93.
[115] Vgl. LINGENS, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit 1988, S. 131–133, 137–139.
ZITIEREMPFEHLUNG
Büttner, Bengt , Schiedsspruch oder Krieg – die Entwicklung der dänisch-schwedischen Schiedsgerichtsbarkeit von ihren Anfängen bis ins 17. Jahrhundert, in: Publikationsportal Europäische Friedensverträge, hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte, Mainz 2009-07-27, Abschnitt 1–34.
URL: <https://www.ieg-friedensvertraege.de/publikationsportal/buettner-bengt-schiedsspruch-2009>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2009091877>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 2 oder 1–4.
Erstellungsdatum: 27.07.2009
Zuletzt geändert: 27.07.2009
